Wenn ein geliebter Mensch verstirbt, ist das für alle Angehörigen eine emotionale Belastung. Gleichzeitig muss die Erbschaft geregelt und der Nachlass verwaltet bzw. aufgeteilt werden. Dabei kommt es immer wieder zu Unklarheiten, die im schlimmsten Fall in Erbstreitigkeiten münden. Ein Grundverständnis des Schweizer Erbrechts und eine sorgsame Nachlassplanung zu Lebzeiten können solche Komplikationen verhindern.
Grundsätzlich gilt, dass das Vermögen der verstorbenen Person nach dem Tod auf die Erben übergeht. Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich in Art. 560 I ZGB (Schweizerisches Zivilgesetzbuch). In diesem Kontext spricht man davon, dass der Nachlass vererbt wird.
Es stellt sich mithin die Frage, was unter dem Nachlass zu verstehen ist? Die herrschende Meinung geht davon aus, dass der Nachlass das gesamte Vermögen des Erblassers umfasst. Zu diesem Nachlass gehören zwei Arten von Vermögen:
So ergibt sich, dass es rechtlich möglich ist, dass Schulden vererbt werden. Die Erben erhalten dann kein Vermögen, sondern müssen für die Verbindlichkeiten einstehen, die der Erblasser hinterlassen hat.
Eine besondere Frage, die sich ergibt ist: Gehört der Hausrat zum Nachlass? Hier kann nur eingeschränkt eine pauschale Antwort gegeben werden. Grundsätzlich gehört nach dem Schweizer Erbrecht auch der Hausrat zum Nachlass. Jedoch kann es im Einzelfall Ausnahmen geben, die den Hausrat nicht zum Nachlass übergehen lassen. Sollte der Hausrat an die Erben übergehen, dann können diese den Hausrat nach freiem Willen verkaufen, übernehmen oder vernichten.
Der Erblasser hat die Möglichkeit den Hausrat explizit an bestimmte Personen zu vererben. Dafür muss er diesen Willen jedoch durch eine letztwillige Verfügung erklären. Letztwillige Verfügungen sind häufig ein Testament oder ein Erbvertrag. Hier können Sie – im Zuge der Testierfreiheit – entscheiden, wer was bekommen soll. So könnten Sie beispielsweise festlegen, dass Ihre Briefmarkensammlung an den Freund A übergehen soll. Ein Testament durchbricht dabei die gesetzliche Erbfolge.
Hausrat sind solche Gegenstände, die zur alltäglichen Lebensführung verwendet wurden. Zumeist handelt es sich um Alltags- und Gebrauchsgegenstände, die im Eigentum des Erblassers gestanden haben. Abstrakte Güter wie Geldvermögen gehören nicht zum Hausrat. Populäre Beispiele für Güter, die zum Hausrat einer Person gehören, sind:
So gering der Wert einzelner Gegenstände auch sein mag, der Hausrat ist ein potenzieller Teil des Nachlasses und kann es somit zu erheblichen rechtlichen Folgen kommen, wenn einzelne Gegenstände aus dem Hausrat entfernt werden.
War der Erblasser verheiratet, ist die Rechtslage bezüglich Hausrat und Nachlass weniger eindeutig und auslegungsbedürftig. Es kommt entscheidend auf den Güterstand an, der während der Ehe geherrscht hat. Das Schweizer Recht kennt drei bzw. vier Güterstände: Errungenschaftsbeteiligung, modifizierte Errungenschaftsbeteiligung, Gütertrennung und Gütergemeinschaft. Die Errungenschaftsbeteiligung ist der ordentliche Güterstand. Dieser gilt immer dann, wenn nichts Anderweitiges in einem Ehevertrag vereinbart wird.
In der Errungenschaftsbeteiligung gilt, dass die Gegenstände, die schon vor der Ehe im Eigentum eines Ehegatten gestanden haben, auch Alleineigentum bleiben. Dieser Hausrat gehört mithin zum Nachlass und muss zwischen den Erben aufgeteilt werden. Anders sieht es aus, wenn es sich bei dem Hausrat um gemeinsame Anschaffungen handelt, die während der Ehe getätigt wurden. Dieser Hausrat gilt als “Errungenschaft” und gehört den Eheleuten zu gleichen Teilen (zur Hälfte). Verstirbt einer der Ehegatten, so muss die Errungenschaft geteilt werden. Die Hälfte des betroffenen Hausrates gehört zum Nachlass. Die andere Hälfte steht weiterhin im Eigentum des Ehepartners.
Ein Beispiel: A und B sind verheiratet. A hat während der Ehe Möbel im Wert von 10.000 CHF angeschafft. Ausserdem hat A eine Küche im Wert von 6.000 CHF in die Ehe eingebracht. B hingegen hat ein Auto im Wert von 20.000 CHF in die Ehe eingebracht. A verstirbt alsbald und es stellt sich die Frage, ob der Hausrat zum Nachlass gehört? Die Küche hat dem A alleine gehört und zählt damit vollumfänglich zum Nachlass. Das Auto gehört der B alleine und gehört mithin nicht zum Nachlass des A. Lediglich die Möbel, die während der Ehe gekauft wurden, sind eine Errungenschaft. Diese mehren den Nachlass des A als Hausrat um die Hälfte des Wertes: 10.000 CHF / 2 = 5.000 CHF.
Bei der Gütergemeinschaft gehört den Ehegatten alles gemeinsam. Lediglich persönliche Gegenstände stehen im Alleineigentum eines Ehepartners. Persönliche Gegenstände sind beispielsweise Zahnbürste oder Gebiss. Selbiges gilt für Hausrat bzw. Gegenstände, die nach den Vereinbarungen des Ehevertrags nicht zum Gesamtvermögen gehören sollen. Im Erbfall wird der Hausrat hälftig aufgeteilt. Etwaiger Hausrat gehört somit zur Hälfte zum Nachlass.
Gleiches Beispiel: Der Wert des gemeinsamen Hausrats beläuft sich auf 36.000 CHF. Die Hälfte – also 18.000 CHF – sind Teil des Nachlass und werden unter den Erben aufgeteilt.
Bei der Gütertrennung ist es umgekehrt: der Hausrat, das Vermögen und die Anschaffungen gehören einem Ehepartner alleine. Es gibt faktisch kein gemeinsames Vermögen. Der Hausrat eines Ehepartners, wird also vollumfänglich zum Nachlass gezählt. Nach dem obigen Beispiel hat A Hausrat im Wert von 16.000 CHF angeschafft (10.000 CHF Möbel + 6.000 CHF Küche). Diese 16.000 CHF sind vollständig dem Nachlass zuzuordnen.
Um zu verhindern, dass der Ehepartner benötigten Hausrat durch die Erbschaft verliert, gibt es ein sogenanntes Ehegatten Vorrecht. Dieses findet sich in Art. 612a ZGB und besagt, dass der Ehepartner ein Vorrecht in Bezug auf das gemeinsame Haus / Wohnung und den gemeinsam genutzten Hausrat hat. Diese Vorrecht gilt gegenüber den anderen Erben. Dieses Recht besteht, damit der überlebende Ehegatte das bisherige Leben weiterleben kann und beispielsweise nicht die gewohnte Umgebung verlassen muss. Damit diese Norm greift, müssen zwei Voraussetzungen vorliegen:
Bleiben wir beim Beispiel von oben: Die Küche, die der A in die Ehe eingebracht hat, gehört zwar vollständig zum Nachlass, kann jedoch von B behalten werden. Art. 612a ZGB erlaubt es, dass B die Küche behält und diese nicht zwischen den Erben aufgeteilt werden kann. Im Gegenzug dafür, muss eine “Anrechnung” erfolgen. Unter einer Anrechnung versteht man in diesem Kontext, dass das Eigentum am Hausrat gegen volle Anrechnung auf den Erbteil des überlebenden Ehegatten zum Verkehrswert des Hausrats übergeht. Das bedeutet: B erklärt, dass Sie die Küche behalten möchte. Nach Art. 612a ZGB ist das rechtlich zulässig. Dafür wird der Erbteil der B um 6.000 CHF gemindert.
Ein Anwalt für Erbrecht ist der Ansprechpartner Ihres Vertrauens, wenn es um die Planung des Erbes oder die Verwaltung des Nachlasses geht. Dieser berät Sie bezüglich Ihrer Nachlassplanung und zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, die die Rechtslage zulässt. Dabei kann auch geklärt werden, ob und welcher Hausrat zum Nachlass gehört. Ausserdem hilft Ihnen Ihr Anwalt für Erbrecht beim Errichten eines Testaments – oder einer anderweitigen letztwilligen Verfügung.
Ebenso berät Sie Ihr Anwalt bezüglich Ihrer rechtlichen Ansprüche und Möglichkeiten im Erbfall. Das Schweizer Erbrecht ist komplex und für Laien häufig nur schwer verständlich. Bei Erbstreitigkeiten – auch über Hausrat – wird die Rechtslage ermittelt, um anschliessend die einschlägigen Ansprüche geltend zu machen. Wenn Sie einen Anwalt für Erbrecht suchen, raten wir Ihnen dazu, unsere Anwalts-Suchfunktion zu nutzen. Mit dieser finden Sie schnell und einfach kompetente Anwälte für Erbrecht in Ihrer Nähe. Vereinbaren Sie kostenlos einen ersten, unverbindlichen Beratungstermin.
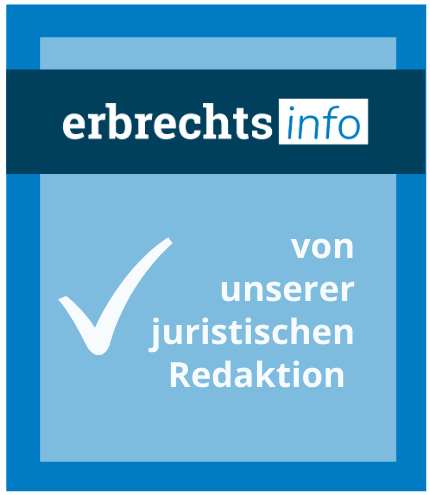
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine juristische Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung