Auch wenn man sich im Zusammenhang mit einer Erbschaftsangelegenheit zu keinen Unklarheiten und Uneinigkeiten kommen sollte, sieht es in der Realität leider dennoch des Öfteren anders aus. Wenn die Probleme dabei insbesondere aufgrund des vorliegenden Testaments oder des Erbvertrags aufkommen, kann das auf eine Ungültigkeitsklage hinauslaufen. Doch was genau ist überhaupt eine Ungültigkeitsklage und für wann kommt diese zum Einsatz? Die Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen finden Sie im folgenden Beitrag.
Mit einer Ungültigkeitsklage können inhaltliche und formelle Mängel einer Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) beanstandet und angefochten werden. Die rechtliche Grundlage ist dabei im Zivilgesetzbuch der Schweiz (ZGB) zu finden, insbesondere ab Art. 519 ff. ZGB.
Wird der Klage stattgegeben, so handelt es sich um ein Gestaltungsurteil. Will der Kläger auch die Herausgabe des Nachlasses erwirken, so muss er in einem separaten oder gleichen Verfahren eine Erbschaftsklage (Art. 598 ZGB) durch eine Klagehäufung (Art. 90 ZPO) einlegen (BGE 91 II 327).
Die Aufhebung, Gesamte oder Teilaufhebung, stützt sich zudem auf Art. 520 des ZGB. Die gesetzlichen Grundlagen zur Verjährung bzw. Verwirkung sind im Art. 521 ZGB sowie im BGE (Bundesgericht der Schweiz) zu finden.Sollte die Umsetzung der Verfügung von Todes wegen, also des Testaments oder des Ehevertrags zu einer Verletzung des Pflichtteils führen, so muss eine Herabsetzungsklage und nicht die Ungültigkeitsklage eingereicht werden.
Mit einer Ungültigkeitsklage kann eine Verfügung von Todes wegen (Testament, Erbvertrag) für ungültig erklärt werden. Das bedeutet, dass dazu dient, ein Testament oder einen Erbvertrag anzufechten. Meist kommt eine solche Ungültigkeitsklage bei Verfügungsunfähigkeit, mangelhaftem Willen oder Formmangel zum Einsatz. Der Gerichtsstand, der in das Verfahren involviert wird, ist grundsätzlich immer der am Wohnsitz des Erblassers.
Die Parteirollen richten sich nach der individuellen Konstellation und den Gegebenheiten des Falls. Sie gilt nur „inter partes“, also zwischen parteilich. Das bedeutet, dass das Testament gegenüber denjenigen Erben Gültigkeit behält, die nicht geklagt haben. Die Ungültigkeitsklage kann nicht durch eine Erbenbescheinigung ersetzt werden und wird entweder im vereinfachten oder im ordentlichen Verfahren behandelt.
Die Ungültigkeitsklage wird in verschiedenen Fällen eingesetzt. Prinzipiell können Verfügungsunfähigkeit, also wenn der Erblasser zum Erstellungszeitpunkt nicht verfügungsfähig war, mangelhafter Wille, Rechtswidrigkeit, Unsittlichkeit und Formmangel Grund für eine Ungültigkeitsklage sein. Je nach Einzelfall ist somit eine der nun folgenden Voraussetzungen zwingend nötig, um eine Klage auf Ungültigkeit der letztwilligen Verfügung erheben zu können.
Wenn die Verfügung von Todes wegen einen Formmangel aufweist, so ist es möglich eine Ungültigkeitsklage zu erheben. Dabei kann dann das gesamte Testament bzw. der gesamte Erbvertrag für ungültig erklärt werden. Haben Personen, die selbst (bzw. deren nahestehende Personen) in der Verfügung von Todes wegen bedacht sind, den Formmangel verursacht, so werden bei einer Ungültigkeitsklage auch nur jene Zuwendungen für ungültig erklärt, die diese Personen betreffen. Diese Fälle werden gleich behandelt, wie die Verfügungsunfähigkeit.
Wurde bei einem eigenständig aufgesetzten Testament das Jahr, Monat oder Tag unrichtig oder generell nicht angegeben und kann dieses auch im Nachhinein nicht anderweitig festgestellt werden, so kann eine Ungültigkeitsklage erhoben werden, sofern das Datum für die Beurteilung der Verfügungsfähigkeit, die Reihenfolge mehrerer Testamente oder die Gültigkeit des Testaments benötigt wird.
Grundsätzlich betrifft eine Ungültigkeitsklage immer den Gerichtsstand, der am Wohnsitz des Erblassers liegt. Durch einen Ehe- oder Erbvertrag besteht auch die Möglichkeit für die Parteien, auch einen anderen Gerichtsstand zu vereinbaren. Auch durch eine Einlassung kann ein bestimmter Gerichtsstand begründet werden und die Vereinbarung eines Schiedsgerichts ist ebenfalls zulässig (auch durch einseitige Anordnung des Erblassers). Die Anordnung eines Gerichtsstandes durch ein Testament ist hingegen nicht zulässig, bzw. nicht verbindlich für die Erben.
Erfolgt die Erhebung der Ungültigkeitsklage durch den Erblasser selbst, so liegt der Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten.
Die jeweilige Aktiv- und Passivlegitimation der betroffenen Parteien ist für die Ungültigkeitsklage von essenzieller Bedeutung. Wann welche Personen aktiv- oder passivlegitimiert sind, können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:
Jede Person, die in einer Verfügung von Todes wegen bedacht ist und der ein erbrechtliches Interesse an der Ungültigkeitserklärung hat, ist auch dazu berechtigt diese Klage zu erheben. Gesetzlichen Erben, die im Falle einer Ungültigkeit des Testaments zum erbrechtlichen Nachfolger werden sind aktivlegitimiert. Auch (eingesetzte) Erben oder Vermächtnisnehmer aus früheren Testamenten, die im Falle einer Ungültigkeit und der damit in Verbindung stehenden Aufhebung des Testaments zu einem Vorteil kämen, zählen zu den Aktivlegitimierten.
Den Gläubigern der interessierten Erben sowie den Erben, die ihren Erbteil dinglich an die Miterben abgetreten haben, haben keine aktivlegitimierte Position.
Die Ungültigkeitsklage richtet sich gegen jene Personen, die aus dem angefochtenen Testament oder Erbvertrag einen erbrechtlichen Vorteil zu Lasten des Klägers ziehen. Sie richtet sich nur dann auch gegen alle weiteren Miterben, wenn die Verfügung von Todes wegen eine unteilbare Einheit bildet. Ist dies nicht der Fall, so kann die Ungültigkeitsklage auch nur gegen einen Teil der Bedachten erhoben werden, wobei sich dann auch das Urteil nur auf diese bezieht.
Liegt Verfügungsunfähigkeit oder ein Formmangel vor, so wird in der Regel die gesamte Verfügung von Todes wegen für ungültig erklärt.
Im schweizerischen Gesetz ist zwar von einer Verjährung die Rede, gemeint sind dabei aber die Verwirkungsfristen, die es bei der Erhebung einer Ungültigkeitsklage zu beachten gibt. Daher gibt es keine Möglichkeit für einen Verjährungsverzicht oder eine einvernehmliche Fristverlängerung. Lediglich die Anerkennung der Ungültigkeit durch den Beklagten ist nach Ablauf der Frist möglich.
Die relative Frist beträgt ein Jahr und beginnt mit Kenntnis der Verfügung von Todes wegen sowie des Grundes der Ungültigkeit. So ist der früheste Zeitpunkt die Eröffnung des Erbganges. Ein blosser Verdacht des Klägers ist dabei nicht ausreichen, ebenso wie der Fall, dass er den Ungültigkeitsgrund bereits früher erkennen hätte müssen, da es auf die wirkliche und zuverlässige Kenntnis ankommt.
Die absolute Frist für die Möglichkeit einer Ungültigkeitsklage beträgt zehn Jahre und beginnt bei Testamenten mit Eröffnung der Verfügung. Bei Erbverträgen beginnt die Frist mit Eröffnung des Erbganges zu laufen (BGE 53 II 101).
Liegt eine Bösgläubigkeit vor, so beträgt die Frist bis zur Verwirkung 30 Jahre. Sie gilt für die Tatbestände der Verfügungsunfähigkeit sowie der Rechtswidrigkeit und Unsittlichkeit der Verfügung, allerdings nicht bei Willens- und Formmängeln.
Die Ungültigkeit einer Verfügung verjährt nicht und ist damit auch nicht an eine Frist gebunden. Sie kann jederzeit mittels Einrede gelten gemacht werden. Die Einrede kann jedoch nur von einem (mit-)besitzenden Erben erhoben werden (BGE 120 II 417, E. 2). Im Zusammenhang mit dem Willensvollstrecker kann davon ausgegangen werden, dass dieser nicht für sich selber besitzt, sondern für die Erben gemeinsam. Daher sind diese als mittelbare Besitzer anzusehen. Dies kann zu Unsicherheiten führen, weshalb darauf geachtet werden muss, ob die Erbenstellung klar und unstrittig feststeht oder nicht.
Die Ungültigkeitsklage zählt zu den erbrechtlichen Verfahren und ist je nach Streitwert ein vereinfachtes Verfahren (Art. 243 ff. ZPO) oder ein ordentliches Verfahren (Art. 219 ff. ZPO). Mit der Einreichung des Schlichtungsgesuches wird das Verfahren rechtshängig. Das bedeutet, dass die Klage nicht noch einmal bei einem Gericht eingereicht werden kann. Nach Ausstellung der Klagebewilligung muss die Klage innerhalb von drei Monaten eingereicht werden. Ansonsten entfällt die Rechtshängigkeit wieder.
Sofern der Sachverhalt liquid (verfügbar) und die Rechtslage klar ist, kann in klaren Fällen das summarische Rechtsschutzverfahren zur Anwendung kommen. Liegen die Voraussetzungen dafür nicht vor, so fällt das Gericht einen Nichteintretensentscheid (Art. 257 Abs. 3 ZPO) und der Kläger wird auf das vereinfachte oder ordentliche Verfahren verwiesen. Dabei bleibt die Rechtshängigkeit gewahrt, sofern die Eingabe basierend auf einem Nichteintretensentscheid beim zuständigen Gericht innerhalb eines Monats neu eingereicht wird. Als Zeitpunkt der Rechtshängigkeit gilt dann das Datum der ersten Einreichung (Art. 63 ZPO).
Der Streitwert einer Ungültigkeitsklage entspricht dem potenziellen Prozess Gewinns des Klägers. Er berechnet sich anhand des Vergleichs der angefochtenen Verfügung mit dessen Folgen der Ungültigkeit.
Der Verlust eines nahestehenden Menschen ist für die Hinterbliebenen oft sehr eine emotionale Ausnahmesituation. Gerade deshalb kommt es leider öfter zu Uneinigkeiten rund um die Abwicklung des Erbes. Sind dann auch noch Unklarheiten oder Unstimmigkeiten in der Verfügung von Todes wegen enthalten, kann das auf eine Ungültigkeitsklage hinauslaufen. Dabei ist es sinnvoll und ratsam, einen fachlich kompetenten Rechtsanwalt zum Fall hinzuzuziehen und sich beraten zu lassen. Dieser weiss, auf welche Punkte Sie besonders achten sollten und wie Sie am besten vorgehen, um Ihre Bedenken klar zu transportieren und Ihre Rechte und Ansprüche durchsetzen zu können.
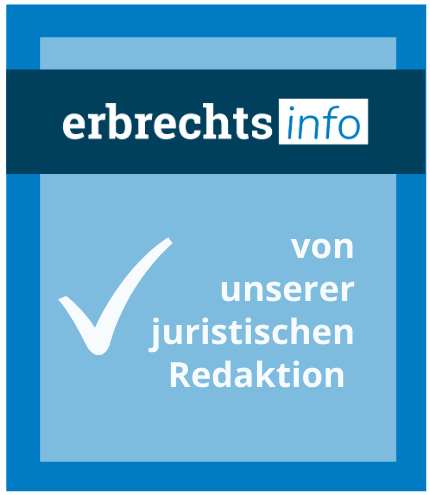
Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine juristische Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung